Die ersten
Otto-Motoren waren stationäre Kraftmaschinen, die mit Leuchtgas
betrieben wurden. Um unabhängig von einem nur selten vorhandenen
Gasanschluss zu werden, was natürlich auch unabdingbare Voraussetzung
im Fahrzeugbau war, experimentierte man mit verschiedenen
Konstruktionen zur Vergasung von leichtflüchtigen Kraftstoffen. Im
Jahre 1883 bestückte Nicolaus August Otto erstmals einen Gasmotor mit
einem Oberflächenvergaser.
Nur wenige Motoren-Enthusiasten werden schon mit einem solch primitiven
Vergasertyp zu tun gehabt haben. Die meisten früher damit
bestückten Ottomotoren wurden später mit einem leichter zu handhabenden
Vergaser üblicher Konstruktion versehen, die schweren und
voluminösen, vermutlich auch nicht immer sicheren Oberflächenvergaser
dagegen landeten auf dem Schrottplatz.
Das Funktionsprinzip ist einfach und anhand der Skizze des
SCHLÜTER-Vergasers leicht zu durchschauen.
Der Grundaufbau besteht aus einem doppelwandigen Gussgehäuse (über 100
kg!), das mit einem Deckel luftdicht verschlossen ist. Der innere
Behölter ist zu etwa 1/3 mit Benzin gefüllt.
(Die Außenmaße: ca. 45 cm Durchmesser, 60 cm Höhe)
|
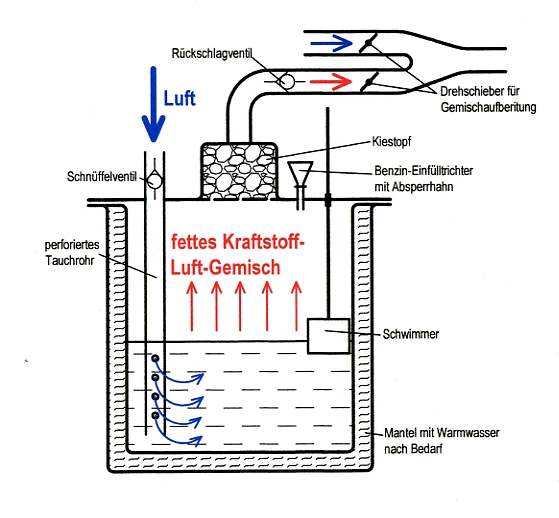 |
Mit dem Ansaug-Takt entsteht ein Unterdruck in diesem Behälter, ein
Schnüffelventil in der Luftzuführung öffnet sich. Die Luft strömt durch
ein perforiertes Rohr, das in den Kraftstoff eintaucht. Die Luft
"gurgelt"
durch den Treibstoff, wodurch ein fettes, kaum zündfähiges Gemisch
entsteht. (Der Vergaser trägt in diesem Fall den Namen zu Recht;
heutige
Vergaser müssten eher "Zerstäuber" heißen, da sich beim Durchströmen
der Luft feine Kraftstoff-Tröpfchen bilden, die erst im Zylinder
komplett verdampfen). Das Gemisch strömt durch den Kiestopf, der in
einer Beschreibung zu einem Benzinmotor von Otto aus dem Jahre 1885 als
"Flammenschutz" beschrieben wird. Zusammen mit einem eingebauten
Rückschlagventil soll so bei Fehlzündungen ein Zurückschlagen der
Flamme in den Vergaser verhindert werden.
Vor dem Passieren des gesteuerten Einlassventils wird über zwei
handbediente Drehschieber (für Gemisch und Frischluft) ein optimales
zündfähiges Gemisch eingestellt.
Gerade für den Betrieb in der kalten Jahreszeit war eine Anwärmung und
damit bessere Verdunstung des Kraftstoffes vorgesehen. Dies konnte
erreicht werden, indem ein Teil des Kühlwassers durch den äußeren
Mantel geleitet wurde. Bei dem hier vorgestellten Motor, der in einem
abgeschlossenen Raum aufgestellt war, ist dies scheinbar nicht
notwendig gewesen, da keine Warmwasserleitung zum Vergaser führte.
Da Benzin ein Gemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen ist, kann
man annehmen, dass erst die leichter flüchtigen Anteile verdunsteten
und sich am Schluss die Anteile mit dem höheren Siedepunkt
anreicherten. Auch die Umgebungstemperatur spielte wohl eine Rolle. Man
musste das Gemisch vermutlich öfter nachregulieren,
den Motor also ständig unter Kontrolle halten.
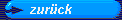
|
 |
 Die
Oldtimer-Seite
Die
Oldtimer-Seite Die
Oldtimer-Seite
Die
Oldtimer-Seite